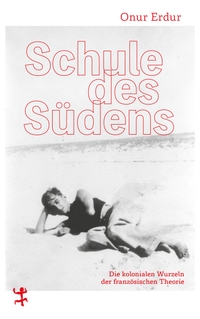Klappentext
In seiner Ideengeschichte in acht Porträts erschließt Onur Erdur eine neue Geografie des französischen Denkens, das die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte: Die Theorien von Intellektuellen wie Michel Foucault, Jean-François Lyotard und Hélène Cixous wurden maßgeblich in Nordafrika oder in der Auseinandersetzung mit den französischen Kolonien geformt. Erdurs Spurensuche führt ihn nach Algier, wo der junge Soldat Pierre Bourdieu mitten im Algerienkrieg seinen Wehrdienst ableistet; ins Küstendörfchen Sidi Bou Saïd nördlich von Tunis, wo Michel Foucault zwischen Sonnenbaden, Strandspaziergängen und ritualisierter Körperkultur zu einer Haltung des philosophischen Hedonismus gelangt; oder nach Casablanca, wo sich Roland Barthes in einer Art Erleuchtung zu einem Romancier fantasiert - und zu Jacques Derrida, Hélène Cixous oder Jacques Rancière, die ihre algerische Herkunft philosophisch reflektieren. Onur Erdurs Perspektive taucht die französisch geprägte Postmoderne ins Licht der Sonne Nordafrikas. Ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung der Hauptwerke des Poststrukturalismus blickt "Schule des Südens" unter das Pflaster der französischen Akademie - darunter glänzt der Strand von Tunis.
BuchLink. In Kooperation mit den Verlagen (Info
):
Rezensionsnotiz zu Die Welt, 29.05.2024
Der Historiker Onur Erdur kann für sich in Anspruch nehmen, der erste zu sein, der dem "kolonialen Setting" der sogenannten "French Theory" die angemessene Aufmerksamkeit zu Teil werden lässt, verkündet Rezensent Wolf Lepenies. Erdur widmet sich wichtigen Denkern der französischen Philosophie und Literatur, wie Michel Foucault, Pierre Bourdieu oder der feministischen Autorin Hélène Cixous. Während der Autor nebenbei eine "zurückhaltende Apologie der Postmoderne" in seinen Band einfließen lässt, wie Lepenies erklärt, geht es vor allem darum, wie die französischen Intellektuellen auf die ein oder andere Weise mit dem Maghreb verbunden waren und wie durch diese Verbindungen durchaus ihre Philosophie beeinflusst wurde. Nicht ohne Ironie schildert Erdur die "Heureka-Momente", die etwa Barthes oder Foucault in den ehemaligen französischen Kolonien einholten. Auch weist der Autor darauf hin, wie die scharfe Kritik am Neokolonialismus Frankreichs, beispielweise eines Jean-François Lyotard, viele nicht davon abhielt, sich trotzdem Plätze in den angesehenen Institutionen ergattern zu wollen, resümiert Lepenies, der von diesem Band durchaus überzeugt ist.
Rezensionsnotiz zu Die Tageszeitung, 11.05.2024
Rezensent Jörg Später wirkt sehr angetan von Onur Erdurs Buch über die kolonialen Ursprünge der französischen postmodernen Theorie der 1980er und 1990er Jahre. Denn zwischen Positionen, die entweder die Konstruiertheit des Orients durch den Westen behaupten, oder gar die gesamte Aufklärung und damit auch die französischen Theorien nur als "westliches Herrschaftsmittel" verurteilen, so Später, schaffe Erdur einen differenzierten, historisch genauen Blick auf die konkreten Verflechtungen: In acht Texten, die je eine Denker oder eine Denkerin, einen Ort und ein theoretisches Moment in den Blick nehmen, legt der Ideenhistoriker frei, wieviel der damaligen Theorie sich erst am und im kolonialen Kontext der maghrebinischen Länder entwickelte. So werden etwa Foucaults Heterotopien an seine Zeit in Marokko und Tunesien geknüpft, Hélène Cixous' differenzfeministische Perspektive an ihre Erfahrung des Andersseins als im Weltkrieg ausgebürgerte Jüdin in Algerien, oder Pierre Bourdieus Habitus-Theorie an seinen dortigen Wehrdienst im Dekolonisationskrieg. Wie Erdur so klarmacht, dass die französische Theorie nicht in einem Pariser Elfenbeinturm entstand, findet Später höchst eindrücklich, argumentativ "umsichtig" und "stilistisch sehr elegant".
Rezensionsnotiz zu Deutschlandfunk, 20.04.2024
Onur Erdurs Essay "Schule des Südens" arbeitet die koloniale Vergangenheit und die postkoloniale Gegenwart der sogenannten "französischen Theorie" auf äußerst lesenswerte Weise heraus, befindet Rezensent Jörg Später. Der Historiker zeigt anhand der Biografien von zwischen 1915 und 1940 geborenen Intellektuellen wie Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jacques Derrida und Helène Cixous, welche Bedeutung der Kolonialismus für die poststrukturalistische Theoriebildung hatte. So entwickelt Bourdieu seine Theorie des Habitus beispielsweise während seines Militärdienstes in Algerien und in Auseinandersetzung mit der systematischen Ungerechtigkeit der französischen Besatzung sowie, schließlich, mit der Gewalt des Dekolonisierungskrieges. Allein Foucault, Denker von Ordnung und Macht, erscheint in Erdurs Darstellung als westlicher Dandy, der zu den neokolonialen Bedingungen in dem Dorf nahe Tunis, in dem er sich aufhält, als er erstmals den Diskursbegriff definiert, schweigt. Mit Augenmaß und historischer Genauigkeit, ohne Determinismus oder Biographismus, zeigt der Autor Später zufolge, wie gelebte Erfahrung und philosophisches Werk miteinander korrespondieren. Erdurs "Schule des Südens" kann er allen Philosophie-Interessierten als heißen Tipp empfehlen.
Themengebiete
Kommentieren